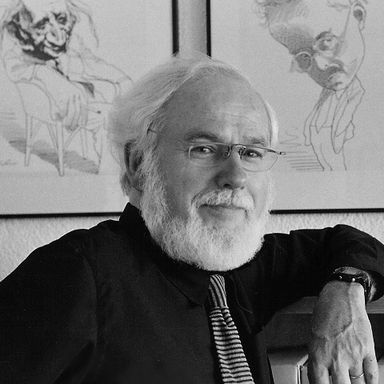Die Republik ist nur so stark wie ihre Community. Werden Sie ein Teil davon und lassen Sie uns miteinander reden. Kommen Sie jetzt an Bord!
Ein in jeder Hinsicht grossartiger, aufschlussreicher Text. Danke dafür und insbesondere auch, dass du die Möglichkeiten des Onlinejournalisten nutzt und deine Links hervorragend setzt, sodass sie dienen ohne den Lesefluss zu stören. Ich werde den Text auf der Geschäftsstelle des SBVV teilen, damit wir uns im nächsten ZOOM-Meeting darüber austauschen können. Wir sind uns gewahr, wie sehr uns die Thematik als Buchbranche betrifft. Die Überlegungen hier sind von einer anderen Dimension, als wir sie in der Fachpresse antreffen und anstellen. Noch einmal Dank.
Liebe Daniel Graf, ich bin begeistert und berührt von Ihrem Text und seiner Sorgfalt und Tiefe. Ich habe in den letzten Monaten so viel Schrilles und Schräges und bisweilen Unsägliches konsumiert, vor allem via Twitter, dass ich mir beim Lesen Ihres Textes sagen musste: "Wie konnte ich nur?! Ich hätte früher Twitterpause machen sollen." Ich mag und schätze, wie ernst und klug Sie das Thema bearbeiten. Ich habe einiges gelernt. Ich habe das Lesen genossen, es war eine Wohltat für meinen - eigentlich geplagten - Geist. Die Pandemiekrise und einige ihrer Auswüchse sind manchmal schwer zu verdauen. Dieser Text hat mich jetzt grad entschädigt! DANKE! Ich habe mir vorgenommen, in meiner Twitterpause jeden Tag mindestens 1 Republik-Text zu lesen (und das war heute schon der Zweite, am "meine Impfungen" wollte ich natürlich schon dran bleiben) - guter Entscheid. Schön. Macht Freude. Bitte mehr davon.
Ganz herzlichen Dank, liebe Christine Loriol!
Ich bin Übersetzerin (weiss), finde den Artikel auch interessant. Es beunruhigt mich, was für fragwürdige Kommentare sich alle dadurch bestätigt fühlen...
Wenn ich einen politischen (oder sonstigen) Text aus irgendwelchen Gründen an eine Kollegin weitergebe, überlege ich mir ganz genau, wer die nötige Sensibilität dafür haben könnte.
Rassismus-Erfahrungen haben oder nicht, kann durchaus je nach Text ein zentrales Kriterium sein.
Team-Arbeit ist grundsätzlich unverzichtbar für eine gelungene Publikation und kann auch in Form von Lektorat erfolgen.
Die (Schweizer) Übersetzungswelt ist sehr weiss, das kann so nicht weitergehen (desgleichen bezüglich Dolmetschen). Auch wir Übersetzerinnen sind gefordert, unsere beruflichen Netzwerke zu öffnen und diverser zu machen, anfragende Auftraggeberinnen auf geeignete Kolleg*innen aufmerksam zu machen und uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir nicht alles abdecken können.
K. V.: ich danke Ihnen für diesen ehrlichen, klaren Beitrag. Quasi aus dem "Innern des Mediums Uebersetzungsarbeit". Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele Texte, die sowohl spannend sind, als auch so, dass Sie diese (woher und von wem auch immer) mit Freude oder gar Lust in unseren Worten Gestalt werden lassen können (und dass "es" sich hoffentlich auch einigermassen rechnet!).
Liebe Frau V., da kann ich mich Frau M. nur anschliessen: Auch von meiner Seite herzlichen Dank für Ihren engagierten Beitrag.
Genau, liebe Karin. In unseren beiden „Sprachvermittler“- Berufen ist das Mitdenken und Gegenlesen essentiel wichtig - nicht nur bei Lyrik, nicht nur bei/für Deutsch. Leider sind und bleiben diese 2 Métiers (leider auch immer noch nicht geschützt) weitgehend unbekannt.
Artikel wie der von Daniel Graf, selber ja „member of our family“, sowie die X Reaktionen darauf, haben somit möglicherweise „un chouia“ dazu beigetragen, diesen Zustand zu beleuchten: grand merci pour cela.
Herzlichen Dank für diesen Text. Es ist erleichternd, Ihren differenzierten Gedankengängen zu folgen und sich so etwas besser orientieren zu können. Und bedrückend, zu vergegenwärtigen, wie sehr dekontextualisierte Zitate und Polemisierungen die „Debatten“ bestimmen. Und wie sehr man als Leser*in diesen Verwerfungen immer wieder ausgesetzt ist, weil es unmöglich ist, bei all diesen Empörungswellen jedes Mal der Sache selbst auf den Grund zu gehen.
Für die vielen schönen Rückmeldungen und die weiterführenden Gedanken möchte ich sehr herzlich danken. Ich glaube, genau darum geht es: gemeinsam konstruktiv weiterzudenken, mit Blick auch auf die schwierigen Fragen statt auf die schnellen Antworten.
Lieber Herr Graf Ihren äusserst vielfältigen und berührenden Beitrag hält mich in seinem Bann. Ich kann Ihnen nicht genug danken dafür.
Leider kann ich nicht angemessen antworten. Nur ein paar Gedanken:
Die Kunst des Übersetzens wird in ganz hohem Masse unterschätzt.( schon nur das Skinny black Girl ist schwierig zu treffen.)
Der Titel Ihres Beitrags: „Der weite Weg den Hügel hinauf“, finde ich viel aussagekräftiger und passender als nur: „Den Hügel hinauf.“
Das Gedicht von Marieke Lucas Rijneveld ist in der Original Fassung von so bescheidener und versöhnlicher Schönheit, dass mir scheint sie ist sehr nahe an das Wesentliche von Amanda Gormans Gedicht.
Vielleicht wäre Ihre Einfühlsamkeit wichtiger gewesen als überdurchschnittliche Englisch Kenntnisse ???
Dieser Beitrag wird mir noch einige Zeit begleiten und ja es wäre schön weniger Debatte und mehr Gespräch zu pflegen.
Liebe Frau W., haben Sie vielen herzlichen Dank, Ihre Worte freuen mich sehr. Und ich kann Ihnen nur beipflichten: Wie Marieke Lucas Rijneveld auf die Situation reagiert hat, zeugt von bewundernswerter Grösse. Schön finde ich übrigens auch das Motto, das Sie unter Ihrem Namen gewählt haben. Vielen Dank nochmals.
Vielen Dank für diesen differenzierten und ausgezeichnet recherchierten Artikel. Das ist REPUBLIK vom Besten.
Ich würde noch etwas deutlicher werden: Wenn die Uebersetzerin unbedingt die gesamte Identität mit der Autorin teilen muss, ist das pure Segregation. Das schadet vor allem Amanda Gorman, die selbst nicht nur als Schwarze sprach, sondern als Amerikanerin.
Siehe dazu auch Tija Sila, Das Magazin, 27. März 2021, S. 6/7.
Wieder einer der eindrucksvollen Artikel der Republik, der eine wundervolle Bestätigung dessen ist, dass ich das richtige Abonnement gewählt habe. Als ich Amanda Gorman bei ihrer Inaugurationsrede erleben durfte - aus der Ferne wie Millionen von anderen Zuschauern auf der ganzen Welt -, war ich, gelinde gesagt: sprachlos. Diese wunderbare junge Frau stellt sich in ihrer jugendlichen und doch schon so reifen Frische hin und «zeigt» der USA und ebenso der ganzen Welt ihre Vision einer humanen Gesellschaft. Mit Wortwitz, Wortspiel und einer packenden Ausstrahlung zeichnet sie ein Bild, das wohl kulturübergreifend und zeitlos ein Ideal darstellt, für das unabhängig von Ethnie, Religion und politischer Ausrichtung sich einzustehen lohnt.
Eine ganz knappe Bemerkung will ich trotzdem noch zum Artikel selber anbringen - bitte richtig verstehen: es ist keine Kritik!
Mir geht es um die Verwendung des Begriffs des Universalismus. Beim Lesen könnte ein wenig der Eindruck entstehen, dass wir darum bemüht sein sollten, einzig nach einem universellen Verständnis der Welt zu streben. Wenn z.B. von einer «Vision der Einheit» geschrieben wird, dann möchte ich das eher als eine «Vision der Einigkeit» lesen. Die Welt in ihrer ungeheuren Mannigfaltigkeit darf nicht zu einem «Einen», zu einer Einheit gedacht, noch weniger gemacht werden. Disparitäten, unterschiedliche Lebens- und Denkweisen sind als solche anzuerkennen und zu pflegen. Wichtig ist dabei allerdings - und da kommt dann der Universalismus zwingend ins Spiel -, dass dies in einem allgemeingültigen moralischen Rahmen passiert, dem die allermeisten Menschen zustimmen können. Es ist dieser Rahmen, von dem Amanda Gorman spricht.
Vielleicht sollten wir weniger an einer «gerechten» als an einer «anständigen» Gesellschaft arbeiten, so wie dies Avishai Margalit vorschlägt und dabei die unterschiedlichen «Sphären der Gerechtigkeit» mit ihren je spezifischen Verteilungsgerechtigkeiten im Auge behalten, so wie die Michael Walzer eindrücklich verlangt. Wir sollten einsehen uns einig darin werden, dass es gerade die Pluralität ist, die unsere Welt so bereichert und wir sollten Einigkeit darüber anstreben, dass wir in einer Welt leben möchten, in der niemand institutionell gedemütigt wird.
Ich denke, das ist es, wofür Amanda Gorman steht!
Ich bin der Meinung, dass nur Weisse die Werke weisser Autoren übersetzen
sollten, nur Juden Judenwitze machen und nur Analphabeten Analphabeten
unterrichten dürfen. Auch nur echte Mörder sollen im Theater Mörder
darstellen dürfen.
He...da versucht gerade einer meinen Account zu knacken...hoffentlich ist
es ein Weisser, dann ist es ja ok...
Schönen guten Morgen Herr K. Ich hab mir mal Ihre letzten paar Kommentare angesehen. Darf ich fragen: Haben Sie beschlossen, in diesem Formum jetzt konsequent auf satirische Beiträge zu setzen? Und falls ja, zweite Frage: Hätten Sie gerne eine Rückmeldung dazu, wie lustig Ihre Einfälle sind?
Bitte, bevor Sie Ihre Meinung darlegen: bitte, bitte geben Sie an, ob Sie schon mal selber ein Gedicht übersetzt haben.
Lieber Herr B., ich weiss nicht, ob Ihr Kommentar an mich gerichtet ist und falls ja, was Sie damit sagen wollen. Aber um auf die Frage zu antworten: Ich bin nie als literarischer Übersetzer hervorgetreten, habe aber für mich privat hin und wieder Lyrik übersetzt und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema literarische Übersetzung (als Essayist, Veranstalter und Moderator). Aber selbst wenn all dies nicht der Fall wäre: Es ist eine sehr irrige Vorstellung, dass Literaturkritiker:innen selbst Romane oder Gedichte schreiben müssen, wie übrigens auch Kunsthistoriker:innen selten Maler sind und Althistoriker:innen ohne Zeitreisemaschine auskommen müssen. Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Kompetenzen – oder?
Lieber Herr Graf
Nein, ums Himmels Willen, keine Kritik an Ihnen! Ihr Artikel ist prima. Ich wolle nur bei Kommentatoren einen Sinn dafür wecken, wie schwierig es ist, ein Gedicht gut zu übersetzten. Mit Klang, Rhythmus, Bildern usw. usw. Und wie viele (nie ganz befriedigende) Lösungen es gibt. So dass der Streit um die übersetzende Person eigentlich unerhört destruktiv ist, weil er Möglichkeiten vernichtet. Schön wäre es, ein paar Übersetzungen nebeneinander zu haben und -- erst mal blind -- die kulturelle Textgetreue zu beurteilen. Und dann mal sehen, was von wem kommt.
Herzlichen Dank für Ihre Rückfrage, die mir erlaubt hat, ein selbstverschuldetes Missverständnis zu korrigieren.
Dank auch an die REPUBLIK!
U. B.
Warum soll dies kein Problem (ohne Anführungszeichen) sein?
Herzlichen Dank für diesen differenzierten, spannenden Texr zu einer Debatte, die sonst völlig an mir vorbeigegangen wäre, gekrönt mit Literaturanalyse. Ein Genuss am Morgen! Auch komme ich nicht umhin den Kontrast zwischen der non-binären Person, die sich auf reife Weise zurücknehmen konnte und den Männern, die als Übersetzer und Feuilletonisten dann das Ganze zur Cancel Culture aufbauschten, zu bemerken. Da ist einigen ihr Partikulares eben immer noch wichtiger als gelebter Universalismus.
Danke. Sehr interessant, wenn man – wie ich – die hochgekochte Debatte nur am Rande via Schlagzeilen mitbekommen und sich verwundert am Kopf gekratzt hat, wie da etwas offensichtlich falsch läuft und überzogen argumentiert wird.
Dieses Anliegen ist von einem totalen, kompletten Wahn-, Irr- und Stumpfsinn. Er bietet nicht die geringste Fläche, um mit ernstem Denken überhaupt anzufangen.
Guten Morgen Herr Leemann, eine starke Meinung! Können Sie bitte erklären, worauf Sie sich mit "dieses Anliegen" beziehen?
Ja. Soeben verfasst. Guten Morgen!
Eine treffliche Verortung eines literaischen Textes. Dass im Übrigen genau zwischen Streit, Debatte, Dialog und dem so notwendigen Gespräch unterschieden wird, macht den Text so erfreulich. Bleiben wir im Gespräch, im Dialog!
Besten Dank, lieber Herr R.!
Fragen die Anderen: Könnten nicht auch Andere den Hügel hinauf? Sagen die Einen: Was? Wir dürfen nicht den Hügel hinauf?! Nein, die Einen sind schon oben. Doch Wir, das sind auch die Anderen.
Eine glänzende Analyse und ein Lesegenuss. Nicht nur, weil der Autor die fehlgeleitete Fragestellung des Übersetzungsstreits blosslegt, sondern weil er das Problem jeder ernst zu nehmenden Identitätspolitik mit seinem Plädoyer «Für den Universalismus» auf jene Argumentationsebene hebt, wo es den Ruch narzisstischer Selbstbespiegelungssehnsüchte verliert und zu einem der fundamentalen Probleme der modernen bürgerlichen Gesellschaft vorstösst, das sie seit der Aufklärung umtreibt. Zu Recht stellt er fest:
«Der Grundgedanke linker Identitätspolitik lautet: Das Versprechen des Universalismus ist (noch) nicht verwirklicht. Und zwar auch nicht in den Demokratien, deren gesamtes Wertefundament und zentrales Versprechen auf dem universalistischen Gedanken fusst: unantastbare Menschenwürde, rechtliche und moralische Gleichstellung für alle, Diskriminierungsverbot, Geltung der Menschenrechte.»
Dazu freilich wies der britische Literaturtheoretiker Terry Eagleton schon 1990 auf ein Dilemma hin – ja ein dialektisches Paradox, das nun auch in der Übersetzungsfrage von Amanda Gormans Gedicht exemplarisch virulent wird:
Sinn und Ziel der Gleichheitsbestrebungen sei nicht – wie es die Aufklärung habe glauben machen wollen – universelle Wahrheit, Recht und Identität, sondern die gleichberechtigte Verwirklichung der je eigenen partikularen Differenz. Es sei lediglich so, dass diese individuelle Besonderheit die abstrakt universelle Gleichheit zu durchqueren und irgendwo auf der andern Seite hervorzukommen habe, ganz woanders freilich, als wo sie heute schon stehe. Konkret: Das Ziel z.B. der Gleichheitsforderung einer jungen Afroamerikanerin ist es nicht einfach, dass sie als ‚Mensch‘ in einem abstrakt universellen Sinn anerkannt wird, sondern es besteht für sie darin, sich qua junge Afroamerikanerin in ihrer partikularen Besonderheit als Mensch voll verwirklichen zu können. Zwischen diesen zwei Welten von abstrakt universalen Subjekten und konkret partikularen Individuen – schon Lessing hatte zwischen «blossen» Menschen und «solchen» Menschen unterschieden und dies als fundamentales soziales Dilemma erkannt – besteht gemäss Eagleton in der modernen Gesellschaft nach wie vor eine groteske Diskrepanz.
Und genau hier liegt das Problem von Amanda Gormans Übersetzung ins Deutsche und nicht etwa in einzelnen Details:
Der Originaltext und der Auftritt der Poetin evozieren auf allen Ebenen sowohl der Laut- und Gebärdensprache wie der Bildmetaphern und Allegorien, der formelhaften Wendungen und Gedanken einen historischen Echoraum, der den afroamerikanischen Messianismus der Gospels und Spirituals, der Reden Martin Luther Kings, eines Jesse L. Jacksons etc. ebenso umgreift, wie er den republikanischen Missionarismus der Gründerväter aufruft; und in diesem rhetorischen Raum des religiös republikanisch-säkularen – aber eben nicht säkularisierten – Amerika oszilliert, vibriert, resoniert und räsoniert die Poesie des 'skinny Black girl', dass es einem bei jedem Anhören das Wasser in die Augen treibt.
Das Übersetzungsproblem beginnt schon beim Titel «Den Hügel hinauf»: Darauf, dass der ‘Hügel’ nicht irgendein Üetliberg ist, den Jogger raufkeuchen, machen die Übersetzerinnen zwar in den Anmerkungen mit ihrem Hinweis auf die «hoch aufgeladene, sehr amerikanische Symbolik» und den Bezug auf den «Capitol Hill» und eine Bibelstelle aufmerksam, aber dass mit diesem Titel das ganze Gedicht in die Emblematik des Berges Zion, des Himmlischen Jerusalem als Ort der Erfüllung des Heilsversprechens und der millionenfach jahrhundertelang gesungenen Erlösungssehnsüchte der afroamerikanischen Gospels und Spirituals gestellt wird – dieser Echoraum bleibt blank.
Noch krasser die Wiedergabe des Verses «We’ve braved the belly of the beast», der völlig frei mit der nichtssagend allgemeinsten Wendung «Wir haben tief in den Abgrund geblickt» übersetzt wird. Wohl steht wiederum in den Anmerkungen der Hinweis auf die biblische Geschichte des Propheten Jonas im Bauch des Walfisches, aber die hübsche autopoetische Pointe, dass die kleine Prophetin-Poetin auf der Kanzel vor dem Kapitol dem Bauch des Biestes trotzt, geht trotzdem restlos verloren. Ebenso die Wendung «… a sea we must wade», wo mit der Wiedergabe «… ein Meer durchmessen» der Bezug auf die mosaïsche Durchquerung des Roten Meers auf dem Weg der Israeliter ins Gelobte Land als einer weiteren Erlösungsallegorie nicht realisiert wird.
KURZ: Das abstrakt Universelle, Transkulturelle, Transreligiöse in den Übersetzungstext, das konkret Partikulare in die Anmerkungen, diesen Eindruck gewinnt man – ob hier von der Technik einer translatorischen ‘Cancel Culture’ gesprochen werden kann? Oder ist es ein Übersetzungsverfahren, das zugunsten der universellen Stimme des 'skinny Black girl' seinen partikularen Resonanz-Körper preisgibt, gar tilgt? Jedenfalls eine Übersetzung, die es nicht schafft, im Sinne Terry Eagletons die Diskrepanz zu überbrücken, im Sinne Lessings das Dilemma zwischen «blossen» Menschen und «solchen» Menschen zu lösen und Jesse L. Jacksons «I – AM – SOME-BODY» übersetzungssprachlich umzusetzen: https://www.bing.com/videos/search?…ORM=VDRVRV
Lieber Herr Böhler, haben Sie sehr herzlichen Dank für diese tiefschürfenden und luziden Überlegungen. Sie führen geradezu mustergültig vor, dass der Weg zu den zentralen literaturkritischen Fragen jenseits eines simplen «Daumen hoch / Daumen runter» immer über die Verbindung von genauer Textlektüre und (literatur-)theoretischer Reflexion führt. Und sie zeigen, wie voraussetzungsreich insbesondere die Übersetzungskritik ist, weil sie im Grunde überhaupt erst dort fundiert ansetzen kann, wo jener Weg für den Ausgangstext schon einmal durchschritten ist. Ich habe aus Ihrem Kommentar viel gelernt, und nicht zuletzt nehme ich ihn als Ermunterung, einmal wieder Terry Eagleton zu lesen. Ein grosses und herzliches Dankeschön dafür!
In dieser Hinsicht fehlt mir in der deutschen Übersetzung das «We» aus «The Hill We Climb» umso mehr. Geht es doch gerade um ein radikal pluralistisches, diverses und inklusives «Wir» (anstelle eines essenzialistischen, homogenen und exklusiven «Wir»). Das Gedicht ist ein Aufruf für «unity and collaboration and togetherness». Für die Realisierung der «verspäteten», aber «nie permanent besiegten», «ungebrochenen», doch «unvollendeten» Demokratie.
Danke für diesen differenzierten, zur Reflexion über Sprache, Gespräche und konstruktiven Austausch einladenden Text. Vor rund 30 Jahren, begleitet von der Vision "Brücken zu bauen", wählte ich den Berufsweg Übersetzer und Dolmetscher. Bis heute erfüllen mich Debatten wie diese und das Eintauchen in neue Sprach- und Wahrnehmungssysteme. #Republik sei Dank, auch für diese #DialogKultur hier!
Lieber Herr Wüest, vielen Dank, auch dafür, dass Sie die Gesprächskultur im Dialog insgesamt hervorheben.
Vielen Dank an Daniel Graf für den klugen und erhellenden Beitrag. Röbi Koller, Vorstand Verein Zuger Übersetzer. www.zugeruebersetzer.ch
Es ist dies ein absolut spannender Beitrag. Vielen Dank. Gerne habe ich mir das Gedicht aber noch einmal (mehrmals) im original-Wortlaut "zu Gemüte" geführt. Da sind so viele Anspielungen, Bilder aus ganz anderem Kontext, aus anderen Kulturen einst und jetzt einverwoben, dass ich selber (naiv wie ich bin) eigentlich gar nicht weiss, wie man/frau das überhaupt übersetzen kann. Menschen, die übersetzen, haben bereits und finden jetzt noch neu meine absolute Hochachtung. So danke ich auch K. V. unten für ihre "Worte von innen". Ich stelle mir vor, dass es schon einmal "Grösse" braucht, einen Auftrag überhaupt abzulehnen, oder gar "sensibel" weiterzugeben. Es kommt ja wohl nicht alle Tage etwas Spannendes und gar noch Lukratives dahergeschwommen?!
Noch zwei eher "randständige" persönliche Bemerkungen.
1.Da ich bei der neuen Zürcher Bibelübersetzung zweitweise als Erst-, Zweitleserin tätig sein durfte, habe ich eine Ahnung davon, wie wirksam auch ein Team sein kann; Menschen mit verschiedenen Funktionen beim Neudenken, "Neuworten". Ich weiss jetzt gar nicht, ob das überhaupt zulässig war, dass ich als weisse Frau aus unserer Zeit über 2-3tausend Jahre alte Worte von Männern aus dem Nahen, mittleren Osten, bestenfalls etwas griechisch angehaucht, habe bedenken dürfen??
2.(noch mehr daneben): wie Sie Marcel Ebel als verdienstvollen Kulturjournalisten bezeichnen können, ist mir echt ein Rätsel. Es wäre mir wirklich ein Anliegen, wenn sich beim Tagilesen auch wieder einmal eine gemässigte Altfeministin und Lesefreundin angesprochen fühlen könnte.
Davvero: à pleurer, ce débat, really!
Wer, wie ich, mit mehreren Sprachen und, bereits als Kleinkind, auf mehreren Kontinenten aufgewachsen ist, und später Sprachen zum Berufsalltag gemacht hat (als dipl. Übersetzerin, Konferenzdolmetscherin. Vertonerin, Sprachlehrerin und Rhetorikcoach: www.caralingua.com) kann nur den Kopf schütteln ob soviel Schwachsinn. Aufträge/Anfragen lehnt man ab, wenn Frau (und Mann) sich SELBER der Sache, dem Thema, der Ausgangssprache, der Kultur, dem Abgabetermin (oder auch wegen... der schlechten Entschädigung) nicht gewachsen fühlt. Nie aber wegen Hautfarbe, Religion, Ernährungs-, Musik-, Kunst- oder... Bettvorlieben!
Danke sehr, D.Graf, für den tollen Artikel und wieder die „Kirche ins Dorf“ gesetzt zu haben.
Während der Lektüre des Artikels schlich sich ein Gedanke an: Warum lässt man das Gedicht nicht einfach in Englisch stehen?
Weil nicht alle Englisch sprechen, und gerade mit dem universalistischen Anspruch sollten wir auch danach streben, solche Gedichte allen zugänglich zu machen.
Es war doch auch ein klein wenig ironisch gemeint.
Trotzdem: Wer sich für Lyrik interessiert, wird wahrscheinlich auch ein bisschen Englisch verstehen.
Wir sollten ALLE Gedichte, in jeder Sprache, überhaupt alles, allen zugänglich machen. Nicht? Oder gilt dies nur für englisches Zügs? Achtung, aufpassen, Falle!
Gegengedanke: Weil ein kapitalistischer Literaturmarkt Profit erzeugen muss.
"The Hill We Climb" kann so wenig in eine andere Sprache übersetzt werden wie damals Woodstock in eine andere Kultur. Es ist halt einfach nicht dasselbe und dabei sein wäre eigentlich das ein und alles.
Nicht nur für den Literaturmarkt. Es geht auch um die Wiederherstellung des Glaubens an das angezählte Amerika im Rest der Welt, um Ideologie, ein Quentchen Kultur inmitten des Verfalls, um Klammern an einen Strohhalm, um den Preis des Missbrauchs und des Verrats. Ein Quentchen Glaube: Übersetzungen sind allerdings auch für die interessant, die gern Fragen stellen und gegen Missbrauch resistent sind.
Spannend!
Ich habe das Gedicht geliebt und bin jetzt etwas schockiert ab der Übersetzung von dieser Passage:
"We’ve braved the belly of the beast."
Der Text im Original deutet - gemäss meiner Interpretation - auf die biblische Geschichte von Jonah hin und mit dieser Übersetzung geht diese Anspielung komplett verloren.
Liebe S. R., das ist ganz treffend beobachtet. Auf diese Bibelstelle wird in der Tat angespielt, was die Übersetzerinnen auch im Kommentarteil der Edition ausführen. Dort wird zudem darauf hingewiesen, dass diese Wendung «zum gängigen Begriff für das Grauen, Chaos, für unhaltbare Zustände und in den USA speziell auch für Haftanstalt und -aufenthalt» wurde. Man kann also zurecht sagen, dass in der Übersetzung bei dem Vers nicht nur klanglich, sondern auch im Anspielungsreichtum viel verloren geht. Der Kommentar zeigt aber auch: Die Übersetzerinnen haben all das nicht etwa übersehen, sondern offenbar (noch) keine kreative Transposition gefunden, um sie im Deutschen wiederzugeben. Was man hier hätte stattdessen machen können? Schwierig. Die Stelle ist ein Paradebeispiel dafür, dass das Übersetzen von Literatur, insbesondere von Lyrik, oft nur durch kreative Umwege gelingt – und manchmal eben auch nicht. Dann hat eine zweisprachige kommentierte Ausgabe aber zumindest den Vorteil, dass der Originaltext diese Dimensionen doch zumindest präsent hält, ebenso wie der Verlust im Kommentar bewusst gemacht wird. Womöglich kann dann in eine spätere Übersetzung noch zu einer überzeugenderen Lösung kommen. Anders gesagt: Ein begleitender Kommentar zeugt immer auch von den Schwierigkeiten des Übersetzens selbst. Und zeigt dadurch, welche kreative Eigenleistung das literarische Übersetzen als eine «unendliche Aufgabe» erfordert. Wenn man so will: work in progress auch hier.
Danke, das ist ein ebenso notwendiger wie einsichtiger Beitrag. Die einzige kritische Frage, die sich mir aufdrängt: Wie gehen wir mit denjenigen um, die immer wieder bewusst 'übers Ziel hinausschießen'? Daniel Graf hat sich für sehr viel Nachsicht entschieden z.B. gegenüber einem Martin Ebel , der nich zum ersten Mal kritische Rufe nach Parizipation und Anerkennung im Literaturbetrieb lächerlich macht. Ebels Argumentationsniveau ist leider schon lange sehr tief gesunken.
Mit der indischen Literaturwissenschaftlerin und Feministin Gayatri Chakravorty Spivak könnte man auch fragen: «Can the Subaltern Translate?» Denn in der Gorman-Debatte zeigt sich exemplarisch die paradoxe Logik des «strategischen Essentialismus». Und die Tatsache, dass «Color Blindness» letztlich «Injustice Blindness» ist.
Subalternität ist ein Ergebnis von hegemonialen Diskursen und wird durch die Praxis der sozialen Ausgrenzung gesellschaftlich hergestellt. «Subalterne» sind also Menschen, die durch Sprache und Strukturen kategorisiert, diskriminiert, stigmatisiert, marginalisiert und exkludiert werden. So u. a. Frauen, Sklaven, Arbeiter, People of Color, LGBTQI+, … (diese «Cancel Culture» kritisieren ihre angeblichen Verächter bezeichnenderweise nicht).
Durch den hegemonialen Diskurs werden aus individuellen Menschen Angehörige von Gruppen, Kollektivsingularen, verallgemeinernde Stereotypen, reduziert auf wenige Eigenschaften, oft mit negativen Vorurteilen beladen. Welche dann zur Erklärung und Rechtfertigung der Benachteiligung und Ausgrenzung dienen (ein Teufelskreis und eine selbsterfüllende Prophezeiung).
Die Definition der Kategorie wird zur identischen und ewigen «Essenz», zum Wesen aller kategorisierten (bspw. rassifizierten, vergeschlechtlichten und sexualisierten) darunter fallenden Individuen. Diese sozialen Konstrukte werden durch die Praxis «real», d. h. sie zeitigen Wirkung, erhalten durch Normierung ein Eigenleben und durch «Normalität» eine gewohnte Alltäglichkeit (a.k.a «ominöse» Struktur).
«Das Andere» ist dabei das Markierte: Das andere Geschlecht, die andere «Rasse», die andere Klasse. «Unmarkierte» haben kein Geschlecht, keine «Rasse», keine Klasse. Sie sind Individuen und verkörpern das Universelle. «Die Anderen» werden ent-individualisiert und damit auch ent-würdigt zu anonymen Sub-jekten. Unter-worfen unter einen Diskurs, eine Kategorie, eine Gruppe. Sie sind das Partikulare. Sie sind Geschlecht, sind Rasse, sind Klasse.
Wie können nun subalterne Stimmen Gehör finden? Politisch repräsentiert werden? Für ihre Gleichberechtigung, ihre Gleichstellung einstehen? Das Dilemma der «unmöglichen und gleichzeitig notwendigen Selbstrepräsentation» ist nun folgendermassen:
Selbstrepräsentation mit der partikularen Kategorie (bspw. «Frauen», «Arbeiter», «Afro-Americans») ist einerseits notwendig, um als Einheit stärker zu sein und so politisch erst wirksam (bspw. im «Frauen-Streik», «Arbeiter-Bewegung» oder «Black Lives Matter»). Diese Essenzialisierung qua Vereinheitlichung qua Identifizierung (deshalb identity politics) hat intern zur Folge, dass die heterogenen, auch intersektionalen Lebensrealitäten aus dem Blick geraten und z. T. neue Ausschlüsse produziert. Und extern, dass durch die Betonung der Identität, die Differenz konflikhaft verstärkt wird.
Andererseits ist sie unmöglich, weil «die Anderen» gerade auch durch ihre Lebensrealitäten erkennen, dass diese partikularen Kategorien nicht natürlich «gegeben» sind und neue und alte Ausschlüsse und Differenzen reproduzieren. Die Kategorien müssten stets als und soziale Konstruktionen innerhalb von Machtdispositiven dekonstruiert und die Identitäten als Zuschreibungen zurückgewiesen werden.
Die grosse Frage ist aber: «Wie können Unterdrückungsverhältnisse kritisiert und überwunden werden, ohne zu benennen, ›wer‹ unterdrückt wird?» Und wie können sonst strategisch und pragmatisch wirksam «die Anderen» für gemeinsame Interessen versammelt werden?
Denn «es gibt kein richtiges Leben im falschen» (Adorno), solange der inklusive, radikal pluralistische Universalismus nicht realisiert worden ist. Der «strategische Essentialismus» ist gleichsam die paradoxe Intervention. Die kritische Theorie dekonstruiert machtanalytisch die essentialistischen Zuschreibungen und die politische Praxis verwendet strategisch die Kategorien weiterhin, da ansonsten die bis auf weiteres «falschen» Realitäten ausgeblendet würden.
Der regressive «Backlash» der Macht und Privilegien konservierenden Kräfte ist jedoch, dass sie diese Komplexität auf einen vulgarisierten simplen Essentialismus reduzieren und das, was ihnen seit je her vorgeworfen wurde, als Kampfbegriffe gewendet zurückwerfen können: «Identity Politics», «Cancel Culture», «Culture War», ….
So ging es auch in der Gorman-Debatte «eigentlich» um eine Kritik der Machtstrukturen im politischen und ökonomischen Feld, um «Repräsentations- und Machtverhältnisse im internationalen Literaturbetrieb» oder die «Auftragspolitik des Meulenhoff-Verlags», wie Daniel Graf schreibt. Denn
Sprechen ist politisch.
Schreiben ist politisch.
Übersetzen ist politisch.
Doch die Reaktion macht daraus platten Essentialismus. Und in einer diskursiven Täter-Opfer-Umkehr gehen die Repräsentations- und Machtverhältnisse vergessen und die Kritisierenden verstummen im Getöse. Doch wer die Kritik als blosse «Symbolpolitik» abtun will oder im Gegenteil als illegitime und daher gefährliche «Identity Politics» und «Cancel Culture» – gar im Namen des Universalismus und Individualismus – zeugt nicht nur von grenzenloser Heuchelei, sondern auch von zynischem Machiavellismus, der die Ungerechtigkeit reproduzieren und perpetuieren will.
«Color Blindness» impliziert «Injustice Blindness».
Insbesondere die Personalie Kübra Gümüşay stiess auf Irritation und Kritik, da sich das Kriterium für ihre Nominierung tatsächlich nicht recht erschliesst und ihre Wahl, so wurde gemutmasst, wohl vor allem mit ihrem Status als Bestsellerautorin zu tun habe.
Bezieht sich dieses «tatsächlich» auf deine eigene Einschätzung, Daniel, oder ist das eine angebliche objektive Tatsache? Warum «erschliesst» sich ihre Nominierung «nicht recht»? Um was geht es denn in ihrem «Bestseller»? «Sprache und Sein» – und das Bewusstsein dafür wie Sprache exkludiert und wie sie inklusiver sein könnte. Wäre das nicht auch ein guter Grund für eine Nominierung?
Lieber Michel, vielen Dank für Deine Anmerkung. Das kann man natürlich als Kriterium anführen und genau das macht der Verlag ja auch. Wirklich überzeugend finde ich das aber nicht, denn Sprachsensitivität – generell und mit Blick auf Exklusionsmechanismen – ist auch eine Grundanforderung an jede professionelle Übersetzerin und hinsichtlich der Thematik hier auch durch Hadija Haruna-Oelkers Expertise abgedeckt. Die Team-Lösung an sich finde ich hier eine sehr gute Idee und letztlich gilt ja: Wenn das Team sich findet und die Aufgabe gemeinsam übernehmen will, dann ist das ohnehin das Entscheidende. Mir hätte allerdings mehr eingeleuchtet, dass man auch speziell die Kompetenz noch abdeckt, um die es literarisch geht, nämlich die Lyrik (in ihrer performativen Spoken-Word-Ausrichtung). Zumal auch der Verlag nicht unbedingt für diese Kompetenz steht.
Man könnte das Trio aber auch im Sinne der Trinität (und Dialektik) von «Sprache» (Strätling) – «Sein» (Haruna-Oelkers) – «Sprache und Sein» (Gümüşay) verstehen.
Aber ich kann deine Argumentation schon auch nachvollziehen. Nur, das Argument, dass doch der «Blick auf Exklusionsmechanismen» «eine Grundanforderung an jede professionelle Übersetzerin» sei, war nicht zuletzt auch das Argument der color blind Kritiker. Dann hätte Strätling – oder irgend ein*e andere*r professionelle*r Übersetzer*in – ja bereits gereicht.
Dass Gümüşay überflüssig sei, da ja «die Thematik» bereits durch die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Hadija Haruna-Oelkers abgedeckt würde, kann man so sehen. Dass man sie aber für etwas Fehlendes – also eine Expertin für «Lyrik (in ihrer performativen Spoken-Word-Ausrichtung)» – kritisiert, kann man ihr wirklich nicht anlasten.
Es stellt sich also die Frage, welche Funktion sie in diesem System einnimmt. Hierzu gibst Du interessanterweise selbst eine mögliche Antwort:
Es ist deshalb alles andere als abwegig, hier auch bei der Übersetzerauswahl den symbolpolitischen Aspekt in die Überlegungen miteinzubeziehen – als einen Faktor neben vielen anderen, die es dann zu gewichten gilt.
Dass neben Haruna-Oelkers mit Gümüşay, als «Enkelin eines türkischen Gastarbeiters in Deutschland», als «praktizierende, Kopftuch tragende Muslima», die sich selbst als «Deutschtürkin und Feministin» bezeichnet, auf dieser «Bühne» sichtbar gemacht wird, könnte gerade in Deutschland ein gewichtiger «Faktor» gewesen sein.
Dies auf «Bestsellerautorin» (in manchen Kreisen ja bereits ein Schimpfwort) zu reduzieren und damit zu suggerieren, dass sie bloss aus Ruhmsucht und Geldgier das Rampenlicht suche, aber wegen angeblich mangelnder Kompetenz «fehl am Platz» wäre und jemand geeigneterem «den Platz stehle», erscheint mir daher als weiterer Versuch, sie «unsichtbar» zu machen.
Ich hoffe, es versteht sich von selbst, dass diese Kritik nicht auf Dich gemünzt ist, Daniel. – Auf den konstruktiv-kritischen Dialog und die Synthese im Heiligen Geist!
Stark, was in diesem Artikel zum Vorschein kommt. Es scheint, als haben einige die wegen der Übersetzung dieses Textes in Rage geraten, den Inhalt eben dieses Textes nicht mitbekommen. Ein übersetzter Text muss auch in den kulturellen Raum der jeweiligen Sprache einfliessen. Ich habe das Video indem Amanda Gorman ihr Gedicht vorträgt nach dem Lesen einer deutschen Übersetzung noch eindrücklicher erlebt.
Herzlichen Dank für diesen differenzierten Artikel, der mich motiviert, mein erst kürzlich erworbenes Abo weiterzuführen.
Vielen Dank, lieber Herr H.!
Seit rund hundert Jahren spielen Weisse schwarze Jazzmusik. Braucht es dazu Erklärungen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihren Kommentar ganz verstanden habe - erklärungsbedürftig scheint mir der Sachverhalt auf jeden Fall. Dass Weisse schwarze Jazzmusik spielen, ist kein Beweis dafür, dass dies historisch nicht problematische Effekte hatte (und womöglich immer noch hat). Wenn es ein Paradebeispiel dafür gibt, wie schwarz Künstler*innen um ihren angemessenen Anteil an (finanzieller, symbolischer, gesellschaftlicher) Anerkennung betrogen wurden, so ist es wohl die Jazzmusik. Als Einstieg in die Thematik eignet sich der Film (und auch das Theraterstück, auf dem dieser basiert) "Ma rainey's black bottom".
Der problematische Effekt ist, dass mehrheitlich weisse, männliche Produzenten Künstler*innen aller Hautfarben ausbeuten und nicht, dass Musizierende sich anderswo inspirieren lassen und untereinander austauschen.
Ein sehr schöner und sehr differenzierter Text, der Zusammenhänge aufdeckt, vielfältige Fragen anstösst und Anregungen in vielen Richtungen gibt. Ganz herzlichen Dank dafür!
An vielen Fäden gälte es weiterzuspinnen.
Ich nehme einen Faden heraus, der mir ganz zentral erscheint:
"Gerade daraus resultiert die immense Herausforderung für jede Übersetzung eines formal durchkomponierten Textes: Die «musikalische», über die Wortbedeutung hinausreichende Dimension von Sprache ist eben mit den spezifischen Mitteln der einen Sprache gemacht. Das führt automatisch in Konflikte zwischen Semantik und Form, zwischen Wortbedeutung und poetischer Gestaltung."
Musik ist universell. Daher „verstehen“ alle Menschen die Musik einer fremden Sprache, auch wenn die Wortbedeutung unverständlich ist.
Das ist die grosse und entscheidende Aufgabe jeglicher Übersetzung: Worte und Gedanken verständlich zu machen und dabei die Melodie des ursprünglichen Textes und der ursprünglichen Sprache zu erhalten.
Das braucht ein aussergewöhnliches sprachliches und musikalisches Einfühlungsvermögen; aber es braucht auch Respekt und Demut.
Eine solche Haltung kann nur universell sein. Deshalb sollten, die Übersetzungs-Aufgabe so verstanden, identitätspolitische Auseinandersetzungen eigentlich in den Hintergrund treten.
Der Grundgedanke linker Identitätspolitik lautet: Das Versprechen des Universalismus ist (noch) nicht verwirklicht.
Für viele Bürgerliche ist es eben einfacher: Der Universalismus wurde schon verwirklicht. Aufbegehren gegen Rassismus, soziale und wirtschaftliche Unterschiede sind dann eben Cancel culture.
Das vereinzelte Individuum (wenn "jede und jeder nur mit sich selbst identisch ist") soll sich gefälligst mit den Verhältnissen abfinden.
Bezeichnend, dass der rechte "shit strom" erst los brach als einem alten weissen Mann widersprochen wurde..
Der weite Weg zum Universalismus... gepflastert mit Dialektik: Erst müssen die bisher nicht Dazugezählten prominent ins Blickfeld rücken, damit sie später auch tatsächlich mit allen "fremden" Aspekten ins Universelle eingehen können. So wird das Universelle erweitert und bereichert und nur so verdient es immer weiter den Namen. .
Dieser Universalismus wird (unvermeidbar?) stets von Teilen als den Interessen von Untervertretenen zuwiderlaufend interpretiert. Sie sehen nur den Augenblick, den Status Quo, die Einzelinteressen und nicht das Ziel. Viele Jahre hab ich diese Diskussion im Bereich der Frauenrechte versucht zu führen. (Z.B. Wo sollen/dürfen Männer mitmachen und mitreden?) Der Anspruch, stets eine momentane Strategie zu führen und immer auch die mit dem langfristigen, (nie ganz erreichbaren) Ziel abzustimmen, ist offenbar hoch. Social Media fördern dieses Denken bisher sicher nicht. Es wird in "Entweder-Oder"-Mustern geschrien, dabei geht es um ein "Sowohl-Als Auch".
Vielen ist nicht klar, dass sie einen Essenzialismus befeuern, der wieder dem Prinzip "Ausschliessung" huldigt, indem sie gewisse Eigenschaften/Rollen als schon fast "heilig" sprechen und alle Beschäftigung damit bei "andersartigen Gruppen" als Missbrauch. Etwas eine Kultur der philosophischen Distanz pflegen, wie dieser Text, tut immer Not.
Zitat: «The Hill We Climb» dürfte nicht nur das derzeit berühmteste literarische Werk überhaupt sein.
Ich möchte mich weder zur literarischen Qualität dieses Gedichts (das ich tatsächlich im Originaltext gelesen habe) noch zur medialen Debatte äussern. Aber zum obigen Zitat: Ich muss doch sehr bitten, das ist hoffentlich nicht ernst gemeint.
Wider alle Hoffnung: Warum soll das nicht ernst gemeint sein?
Na gut, stellen wir mal die Frage nach dem Berechtigtsein zu einer Handlung.
Gehen wir von der Forderung, die hier gestellt aus, dann muss grundsätzlich GESCHICHTLICH geklärt werden, wer wann wohin kam und warum. Und wie es vorher war.
Man kann fraglos akzeptieren, dass die Annahme, Weisse (per se) können dies und jenes nicht, was natürlich rassistisch ist, aber lassen wir dies mal aussen vor, ihre mögliche Berechtigung hat, allerdings ist es natürlich dann auch so, dass das Gegenteil ebenfalls zuträfe: schwarze/gelbe/rote/kleinwüchsige/lange Bohnenstangen/dicke, dünne, dümmere, hochintelligente, grossbusige, kleinbusige, Alte, Junge können "das Andere" nicht. Denn sie SIND nicht so.
Ja. Sind sie nicht. Unbestritten.
Also darf kein Schwarzer Uebersetzer die Werke von ... sagen wir mal, Goethe anfassen. Der wird es nun wirklich nicht verstehen, was ein Weisser von anno dazumals für ein Denkgebäude hatte und mit den anderen Weissen interagierte. Wenn ich als Weisser es schon nicht kann...
Weiter - es geht selbstverständlich nicht nur um Gedichte, in dieser Diskussion. Da erscheinen Museumsgegenstände (Raubkunst, koloniales Erbe, etc), Frisuren (!), Federschmuck u.v.m. - im Grunde dreht es sich um alles. Deshalb werfe ich kurz auch die Kleiderfrage auf:
Darf irgend jemand, der nicht weiss ist, Jeans anziehen? In ein Flugzeug steigen, nein, genauer, ein Flugzeug BAUEN? Dürfen Afrikaner farbige Kleider herstellen und tragen? Schliesslich brachten Weisse diese nach Afrika (Kolonialisten!). Buchdruckmaschinen? Nein, diese sicher nicht! Weisse Erfindung. Nur Weisse dürfen die in Afrika bauen und Afrikaner müssen sich immer bewusst sein, halten sie ein Buch in den Händen, "wer dies erfunden hat".
Ja, wer hat eigentlich was irgendwann mal erfunden? Unter welchen Umständen? Welche persönlichen Merkmalen hatten die Erfinder und die, die die Erfinder finanzierten, falls sie es taten?
Wer hat das Feuer erfunden? Metall? Baukunst? Herrschaft, das Rad? Unter welchen Bedingungen? Ausbeuterischen? Waren die gar Sklaven?
Und wer hatte das Toupet, dies alles zu kopieren! Sich kulturell anzueignen!!!
Mann, da haben wir noch sehr viele offene Fragen!
Für mich ist eines klar: Wir brauchen, wie seit Beginn der Menschheit, BRUECKEN zueinander, denn wir sind leider sehr beschränkt (ich im Besonderen, natürlich) und keine Trenngräben mit loderndem Teer.
Diese "gutgemeinte" (wirklich?) Differenzierung ist Gift für das Miteinander und nicht etwa Balsam oder gar eine neue, gesunde Basis für ein neues Miteinader.
Jeder sollte sich geehrt fühlen und in seiner "Botschaft" unterstützt, wenn seine Gedanken und Taten sich über die Welt erstrecken und somit von anderen Menschen aufgenommen werden.
Eine ausgestreckte Hand ist nicht zu vergleichen mit rudimentären, oberflächlichen, absurden, lächerlichen Differenzierungen.
Mit Unterscheidungen ( darin sind wir Menschen sehr stark) schaffen wir mit Sicherheit keine Geborgenheit in der Welt.
Aber wer sagt schon, dass wir das, tief in uns, überhaupt wollen?
Vielleicht sind Sie im Artikel nicht bis zu diesem Absatz gekommen?
Es ist eine denkbar falsche Vorstellung, dass bestimmte Identitätsmerkmale die Voraussetzung seien, um angemessen übersetzen zu können (oder um Texte verlegen, besprechen, ja nur schon lesen zu können, denn dieselbe Überlegung müsste dann konsequenterweise für jede Art des Umgangs mit Literatur gelten). Würde also – und dieser Konjunktiv ist wichtig – zum Beispiel behauptet, dass Weisse qua Hautfarbe nicht in der Lage oder nicht befugt seien, Texte von people of color zu übersetzen, die Argumentation wäre blanker Essenzialismus. Und müsste unmissverständlich als gefährlicher Unsinn zurückgewiesen werden.
Doch natürlich, Herr H., bis dorthin und gar bis zum Ende. Allerdings war das Ende des -guten!- Artikels nicht das Ende meines Denkens. Denn in dieser Sache geht es nicht bloss um dieses Gedicht. Schlagen Sie die NZZ von heute auf, letzte Seite - und die von gestern, vorgestern - überall prangen Reflexionen über das "Anderssein" und die dabei gezogenen Grenzen. Es ist für mich ein Unterschied, ob man einer Sache auf den Grund geht und dann gemeinsam die Fehler (meist beider Seiten) analysiert oder einfach mal eine Anfangslinie zieht, wo auch immer geschichtlich, und von dieser aus hart gegen andere argumentiert. Kein Missstand wird sich auf diese Art wirklich verarbeiten lassen. Vor allem dann nicht, wenn die von einem selber eingenommene Position genau die ist, die man dem anderen vorwirft.
Darf jemand mit heller Hautfarbe der Amanda Gorman ihr Gedicht übersetzen? Oder eine Rastafrisur tragen? Die Frage ist doch viel eher: wollen wir endlich den Rassismus überwinden? Wenn ja, sind die ersten beiden Fragen irrelevant. Und meiner Meinung kontraproduktiv.
Wer soll den Rassismus überwinden, wenn nicht jene, die am stärkeren Hebel sind?
Das System selbst muss systemische Benachteiligung beseitigen, nicht die Benachteiligten.
Die Mehrheit muss Minderheitenschutz beschliessen, nicht die Minderheit.
Zusatzfragen: Darf eine Firma altes Medizinalwissen patentieren lassen? Durfte Paul Simon südafrikanische Rhythmen als die seinen verkaufen?
Zu Ihrer ersten Zusatzfrage: mit dem Nagoya-Protokoll wurde eine internationale Vereinbarung getroffen, welche solche Vorteile teilweise ausgleichen soll. Es bleibt aber viel zu tun. Weitere Infos: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/h…okoll.html
Selbstverständlich darf ein Buch über Thermodynamik von Menschen übersetzt werden, ungeachtet Vielem, so lange sie Thermodynamik verstehen und beider Sprachen mächtig sind. Oder über Tee, ...
Der Punkt an der Debatte wird im Text wunderbar illustriert. Ich würde viel wetten, dass Marieke Lucas Rijneveld als Enby in der deutschen Sprache das Gedicht nicht so hätte kulminieren lassen:
und du willst ja gerade Verbrüderung (…)
Und ebenso würde ich viel wetten, dass die übersetzende Person, Ruth Löbner, nicht Enby ist und daher, ohne es zu bemerken, den Text verfremdet.
Rijneveld hätte das Gedicht garantiert in Deutsch nicht in was auch immer kulminieren lassen, weil sie das Gedicht nicht ins Deutsche sondern ins Niederländische übertragen sollte. Und Ihr Hinweis, dass Löbner als "nicht Enby" den Text verfremde, ist sinnlos: Gorman selbst ist auch nicht Enby - hat sie dann selbst ihren Text auch "verfremdet"?
Da scheint ein Missverständnis vorzuliegen, oder gar viele.
Das Zitat bezieht sich auf ein (vermutlich) in niederländischer Sprache verfasstes Gedicht von Marieke Lucas Rijneveld. Und da wette ich, dass im Original ein Begriff steht, der weder patriarchal noch binär ist.
Genauso muss ein Gedicht, das Rassismus thematisiert, von einer Person übersetzt werden, die Rassismus erfahren hat. Weil anderen Menschen schlicht und einfach der Erfahrungshintergrund fehlt.
Abgesehen davon, dass am Ende jede und jeder nur mit sich selbst identisch ist?
Nicht einmal das: «Je est un autre.» (Rimbaud)
Oder amerikanisch gesprochen:
"Do I contradict myself
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes.)
Whitman – nice!
Und noch auf gut Deutsch:
In der Moral behandelt sich der Mensch nicht als individuum, sondern als dividuum.
Hahah, sehr gut. Man kann auch auf Freud zurückgreifen, wenn es um das Ich geht, das man im Grunde nicht im geringsten im Griff hat.
Zur Ergänzung des gar sozialromantisch gefärbten Lebenslaufs von Amanda Gorman: Sie absolvierte die New Roads Privatschule in Santa Monica und ist heute Havard-Absolventin (Soziologie) und Modedesignerin: (CNN am 26.1.2021: "On Monday, the 22-year-old Harvard graduate completed a deal with IMG Models, which represents fashion heavyweights like Kate Moss and Gisele Bündchen, the agency confirmed to ..."). Hier weiss man nur, dass sie auch noch Poetin ist und bei der Inauguration von Joe Biden ein Gedicht vortrug, das nach der Dunkelheit der Ära Trump den versprochenen gesellschaftlichen Neustart perfekt intonierte.
Und ihren Text darf eine nicht-binäre Weisse nicht übersetzen und ein weisser Mann schon gar nicht. Wenn jemand aufgrund seiner Hautfarbe etwas nicht können darf, nennt man das Rassismus. Und wenn er/sie/es aufgrund des Geschlechts etwas nicht darf, ist es Sexismus. Ist nicht schwierig. Aber die Anwendung der simplen Begrifflichkeiten macht Bauchweh, wenn auf einmal die Falschen zu Tätenden werden.
Doch, ich habe gelesen, dass bei der nicht genehmen Übersetzerin die falsche Hautfarbe unwichtig sei und sie selbst gesagt habe, sie könne zu wenig Englisch. (Nicht vergessen, es geht um die Übertragung eines poetischen Textes, und einen Entwurf hat niemand gesehen; was für eine Anmassung, sich schon vorab ein Urteil anzumassen.) Allerdings las ich auch den Artikel in der FAZ vom 8.3.21 zum Thema, wo das Anforderungsprofil genannt wurde, dem die zu wenig weibliche und zu wenig schwarze, nicht-binäre Fru Rijneveld nicht entspricht:
"... Ausgelöst durch eine Kolumne der schwarzen Aktivistin Janice Deul in der Zeitung „de Volkskrant“, in der sie die Merkmale „jung“, „weiblich“ und „unapologetically black“ (was wohl so viel wie selbstbewusst schwarz bedeutet) als wesentliche Qualifikationen für diese Übersetzungsarbeit nannte, brach ein Proteststurm gegen Rijneveld los...".
Und ich finde, dass die Erfordernisse "weiblich" und "unapologetically black" hier nicht einfach unter den Tisch fallen dürfen.
Traurig ist es, dass beim Bestreben für die Gleichberechtigung der Menschen so viel Energie in Blödsinn investiert wird. Welchen PoC werden redlining oder racial profiling (genialer Begriff, wenn es doch keine Rassen gibt) oder groteske Wahlrechts-Erschwerungen erspart, wenn Kaukasier (noch so ein amerikanischer Begriffswitz) Gedichte von PoC nicht übersetzen dürfen? Welche Frau bekommt gleich viel Lohn wie ein Mann, wenn ihre Fürsprecherinnen sich am Gendersternchen abarbeiten? Mir kommt es vor, als habe Macchiavelli das erfunden, um Verbesserungen zu verhindern.
Etwas Mühe macht mir der Ausdruck «symbolpolitisch». Nicht unbedingt hier, doch ganz allgemein. Denn er suggeriert etwas wie «weniger politisch», ja gar «nicht eigentlich politisch», à la: «Ach, das ist doch nur Symbolpolitik!». Aber gerade Symbolpolitik ist durch und durch Politik. Und oft gar wirkmächtiger als die «reale» Politik. Etwas, das den alten Griechen und Römern mit ihrer Disziplin in Rhetorik bewusst war. Ist der Mensch doch nicht nur ein zoon politikon, sondern auch ein animal symbolicum (Ernst Cassirer).
Der performative Sprech-Akt und erst recht der inaugurative ist höchst politisch, «kreiert» er doch einzig durch Symbole eine intersubjektive Realität. Scheinbar aus dem «Nichts» entstehen getaufte Identitäten, geschlossene Ehepaare oder gewählte Präsident*innen. Politisch war immer auch schon die Spoken-Word-Peformance in der Tradition der African-American community. Jener «subalternen», marginalisierten und oft mit Gewalt zum Schweigen gebrachten Stimmen also, die so – wie auch in der Musik – ihren Ausdruck, ihre «Bühne» finden konnten (nicht ohne appropriiert zu werden).
Es geht nicht irgend ein «Hügel hinauf», sondern «The Capitol Hill, We Climb». Und es ist nicht das exklusive «We» der Trump-Anhänger, welche zuvor den Hügel stürmten, sondern ein inklusives «We». Dieses «Wir» fehlt mir leider bereits in der deutschen Übersetzung des Titels. Dieses «Wir» wird gleichsam unsichtbar gemacht. Durchgestrichen. Doch durch das Gegenüber des englischen Originals sichtbar durchgestrichen.
Diesen Beitrag verstehe ich nicht und es fehlen Ihre, von mir hochgeschätzten, weiterführenden Verlinkungen.
Symbolpolitik soll „weniger politisch“ sein, aber gleichzeitig „durch und durch Politik“ bzw. Sogar „wirkmächtiger sein“. Für mich tönt das hoch widersprüchlich. Eine weitere Erläuterung würde beim Nachvollziehen helfen. Irgendwie tönt es sonst nach Strohmann, aber ich wüsste nicht gegen wen oder was.
„ Politisch war immer auch schon die Spoken-Word-Peformance in der Tradition der African-American community“ kann ich, mangels Wissensschatz, nicht nachvollziehen/verstehen. Der einzige Einfall - Rapp oder HipHop - erscheint mir zu sehr als Strohalm des Versuchs des Verstehens.
Sie haben meine Neugierde geweckt. Wenn Sie mögen, würde ich es schätzen, dass Sie noch eine kleine Erklärung nachschieben.^
Edit:
Vielen Herzlichen Dank für die Verlinkung und die damit einhergehende Nachvollziehbarkeit auch für mich.
Gerne liefere ich Ihnen die Links nach. Dass Symbolpolitik «weniger politisch» sein soll, finde ich ja gerade eine irreführende Darstellung, denn das Symbolische steht nicht nur im Zentrum des Politischen, sondern auch des Anthropologischen. Damit löst sich der scheinbare Widerspruch auf.
Der angebliche «Strohmann» war explizit nicht Daniel Grafs Gebrauch des Ausdrucks «symbolpolitisch», sondern mein Argument zielte auf das eigentliche Problem, dass das Symbolpolitische generell im Diskurs nicht wirklich, nicht wichtig genug genommen wird. Oft wird es als «blosse» Symbolpolitik abgetan, der man nicht zu viel, ja am besten gar keine Aufmerksamkeit schenken soll (das wäre nur Ablenkung). Doch auch im vorliegenden Fall hätte man sehen sollen, wie das Symbolische, das Politische und das Ökonomische systematisch zusammenhängen. So dass es nicht zur simplifizierenden und so unglaublich drögen kulturkämpferischen (Feuilleton-)Debatte gekommen wäre.
Einer der heute noch bekanntesten Spoken Word Artists der African-American community ist wohl Gil Scott-Heron, der mit seinem Stück «The Revolution Will Not Be Televised» Spoken Word Poetry als Kunstform populär machte. Die wichtigsten Inspirationsquellen waren die Spirituals, der Blues, die «Harlem Renaissance» und die Civil Rights Movement (MLK's «I Have A Dream» oder Sojourner Truth's «Ain't I a Woman?»).
à votre service
Die Gefahr ist, dass Verlage, Studios, Museen und andere Kulturbetriebe ganz rational auf diese Wellen der Empörung reagieren und entsprechende Abteilungen schaffen, wo ausschliessliche zertifizierte Mitglieder gewisser als wichtige empfundener Identitäten Kultur von und dann immer mehr auch nur noch für diese Gruppen produzieren - natürlich mit kleinem Budget. Dieses Segregation, "separate but equal" (aber eben dann trotzdem nicht sehr "equal") gab es in der Vergangenheit schon und es war nicht gut! Gerade die "African-American Community" hat Jahrzehnte lange für einen Platz am grossen Tisch der Mehrheitskultur gekämpft und will wohl kaum ernsthaft zurück in ein kulturelles Reservat.
Die Uebersetzung ist missraten («Denn amerikanisch sein ist mehr als / der uns überkommene Stolz – / es ist die Vergangenheit, die wir beerben / und wie wir gutmachen werden.» ???), und man kann Paul Jandl (NZZ) beipflichten: "Tatsächlich hätte man es wahrscheinlich lassen sollen, «The Hill We Climb» zu übersetzen, denn dieses Gedicht ist, wie es eben ist: in seiner Erhabenheit auf einen Augenblick hin komponiert..."
Allenfalls sollten alle die Originalversion lesen und Leute, resp Uebersetzer, können Interpretationen und Ergänzungen zu einzelnen Passagen liefern. Aber ein paar Seiten in einem Interpretationsbuch ist natuerlich weniger attraktiv wie einen hochgehypten umstrittenen Besteller zu schreiben.
Ob wir es wollen, oder nicht, immer spiegelt sich in der Art von Opposition auch die vorherrschende Macht.
Denn welche Möglichkeiten DissidentInnen zum Reagieren haben, bzw. welche Strategien für sie am erfogversprechendsten sind, geben die Rahmenbedingungen des Regimes vor.
So ist die Gewaltfreiheit das zentrale Mittel im Kampf gegen einen hochgerüsteten Militär- und Polizeistaat, da sie die Herzen der Weltöffentlichkeit gewinnen kann, so dass über internationalen Druck und Sanktionen eine Diktatur zu Zugeständnissen und Lockerungen gebracht werden kann, währenddem das Gegenteil eines fanatisch-todesverachtenden , bewaffneten Terrors bei der Weltöffentlichkeit Abscheuh erzeugt und dem Regime den Vorwand gibt, seinen Staatsterror als "Krieg gegen den Terror" zumindest teilweise zu legitimieren, wie das in Syrien genau so passierte.
Eine ähnliche Konstellation besteht im asymetrischen Machtkampf zwischen den Afro-AmerikanerInnen und der auch heute noch rassistisch privilegierten weissen Mehrheit im Land:
Auch wenn es die besonders emotionalen Schwarzen zum platzen wütend macht, dass mit der Wahl von Trump das Rad der Geschichte zum x-ten Mal weit zurückgedreht wurde und dass weitere abscheuliche, sogar vor laufender Kamera begangene Tötungen von Schwarzen durch Polizisten begangen wurden, die an die Lynchmorde des Ku Klux Klan erinnern, müssen sie ihre Wut und ihre Verzweiflung darüber kontrollieren, zurückhalten und ein weiteres Mal herunterschlucken, weil jede wütende (und verständliche!) Randale brave
BürgerInnen und WählerInnen erschrecken könnte, so dass sie beim nächsten Mal wieder Trump wählen würden, der für "Ruhe und Ordnung" steht, wobei sein "Ruhe und Ordnung" selbstredend NICHT für seine Chaos-Truppe in der Regierung und für seinen schwer bewaffneten Wutbürger-Mob gelten sollen...
Was passiert aber mit einer unterdrückten Aggression der Schwarzen, die nicht raus kann, weil sie -aus taktischen Gründen- nicht raus darf?
Sie sucht sich ihre Bahnen genau dort, wo sie herunter geschluckt wurde: Bei den Entrechteten und Geknechteten SELBST, die durch die Umstände dazu gewzwungen werden, gute Miene zum bösen Spiel machen zu müssen!
Zum künstlichen "Cheese"-Lächeln der amerikanischen Bling Bling-Hollywood-Disneyworld gesellt sich also "Der gute Schwarze", der als "Edler Wilder" ein Vorbild in Sachen Polikal Correctness, Tugendhaftigkeit und christlichem "Vergeben können" "demokratischer, als die Demokraten" und "weisser als die Weissen" sein soll.
Als geneigter Leser merkst Du, dass sich genau darin eine besonders üble Form der Boshaftigkeit zeigt, die Du auch im R. Steiner-Millieu erleben kannst, wo alle einander anlächeln, aber wehe Du kaufst den falschen Bio-Müsli-Riegel, auf dem nicht "demeter" und "vegan" steht!
Auf den Fall von Belarus angewendet, frage ich mich, warum die Opposition dort penetrant den Belarusischen Nationalismus kultiviert und rot-weisse Fahnen schwenkt, ähnlich wie sich die AfroamerikanerInnen immer besonders inbrünstig mit dem "American Dream" verbünden müssen.
Mir wäre doch eine solche perverse "National-Gemeinschaft" schon längstens gründlich vergangen, wenn ich täglich erlebte, wie die EIGENEN "Sicherheitskräfte" auf die EIGENEN VolksgenossInnen einprügeln!
Aber eben: Auch hier versucht der Volksaufstand, sich mittels zelebriertem Nationalismus "unverdächtig" erscheinen zu lassen.
Diese taktische Finte wird sich langfristig rächen, wie wir das im ganzen europäischen Teil des früheren "Ostblocks" mitverfolgen konnten...
Nur ein kleiner Einschub: Schwarze haben in den USA mehrheitlich Trump gewählt. Das ergibt dann natürlich ein Erklärgungsnotstand. Den aber der gut meinende Identitäre problemlos umschifft.
Weil es totaler Quatsch ist.
https://edition.cnn.com/election/20…-results/6
https://www.nytimes.com/interactive…ident.html
Biden hat wohl rund 88% der Stimmen der Schwarzen erhalten.
Ich glaube nicht, dass Trump bei den AfroamerikanerInnen ankommt.
An seinen Rallys ist jedenfalls kaum ein schwarzer Kopf mit "America First"-Käppi zu sehen.
Hingegen könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass seine Politik sehr viele Latinos im Lande anspricht. Ich denke da an konservative Werte, wie die Katholische Kirche, die Familie, die bewaffnete Selbstverteidigung und an den Hass auf alles "kommunistische".
In Südamerika, das von den USA als "Hinterhof der USA" gesehen- und auch behandelt wird, werden solche "konservativen Werte" durch die allgemeine Degradierung der Verhältnisse sogar noch gefördert! Ohne Grossfamilie und Anbindung an eine einflussreiche Mafia-Organisation kannst Du in diesem "Drittwelt-Getümmel" schlicht nicht überleben!
Die Katholische Kirche wird in einem solchen Umfeld nicht als Freizeit-Folklore, sondern als Erweiterung der Familie gesehen, aus der man nicht austreten kann, ohne damit Selbstmord zu begehen...
Ganz ähnlich ist es im Grunde bei Denjenigen, die sich mit der Guerilla verbünden, weil sie arme Squater, SklavenarbeiterInnen und Kleinbauern sind.
Warum ich darauf komme?
Ich beobachte, wie sich meine Frau und ihre Verwandten aus den Philippinen verhalten, von denen drei Geschwister mitsamt Familie in den USA leben.
Zuerst waren sie schwarz (=illegal) und mussten sich verstecken. Dann, nach entbehrungsreichen Jahren, gab es eine Amnestie, und heute, mit Familiennachzug, leben sie glücklich und zufrieden.
Als ich mich einmal über Trump lustig machte, indem ich seinen -wie gewohnt- dümmlichen- Satz "Paris is no more Paris!" nachäffte, hörte ich in der Tischrunde mit meinen philippinischen Verwandten, die sonst immer sehr lustig drauf sind, gleichsam die Grillen zirpen.
Wie ich später erfuhr, waren die NICHT gegen Trump, und zwar weil er ihnen versprach, die zusätzliche über die mexikanische Grenze in die USA drängenden Latinos davon abzuhalten, das zu tun, was für alle bisher erfolgreich Eingewanderten eine bedrohliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt bedeutete.
In den täglichen Begegnungen in Los Angeles verhielten sich meine philippinischen Verwandten gegenüber MexikanerInnen immer ausgesprochen warm und herzlich! Man teilte eine subtropische Mentalität mit spanisch-kolonialer Vergangenheit und mit einer US-Amerikanisch-neo-kolonialen Gegenwart. Aber man wollte nicht noch mehr von diesen Seelenverwandten in seiner unmittelbaren Nachbarschaft haben...
Die Verhältnisse sind also kompliziert und deshalb nicht leicht zu verstehen, vielschichtig und widersprüchlich, je nach Art der Interessenlage.
Aber irgendwann bekommen wir doch ein wenig den Durchblick und können dann vielleicht auch nachvollziehen, warum die Beliebtheit der Italiener im Tessin so weit abgenommen hat, dass sie in der Rangliste noch hinter die Deutschschweizer zurückgefallen sind, die einfach als "schrullig" wahrgenommen werden (Kurze Hosen, Socken in den Sandalen und so...), währenddem die Italiener auch um die Arbeitsplätze buhlen und dabei mit Tieflohn-Akzeptanz operieren...
- Mitglied werden
- Angebote
- Gutschein einlösen
- Anmelden
Republik AG
Sihlhallenstrasse 1
8004 Zürich
Schweiz